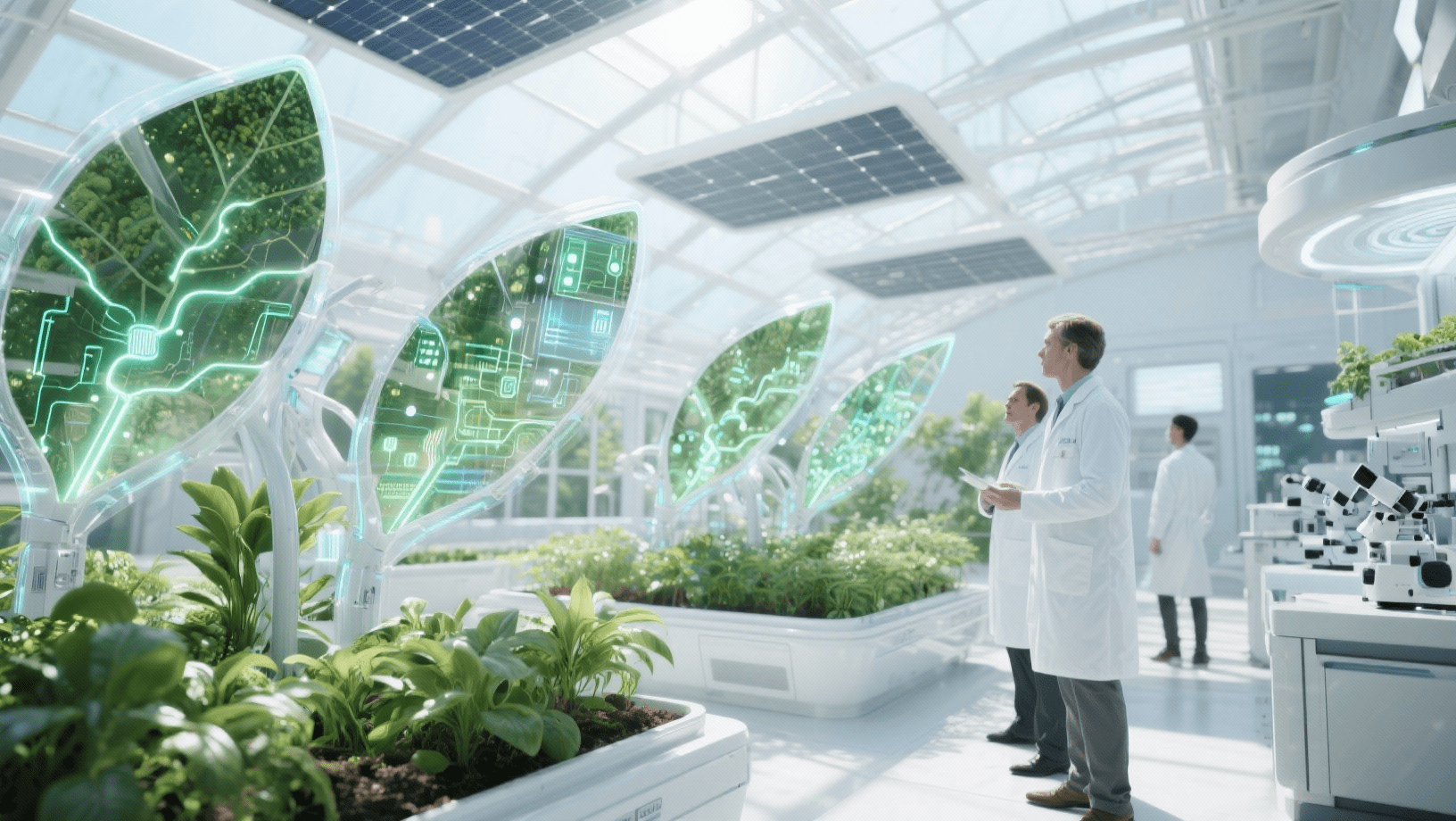Die Wissenschaft steht vor einem bahnbrechenden Moment in der Energieforschung. Forschern ist es gelungen, künstliche Photosynthese mit einer Effizienz von 30 Prozent zu realisieren – ein Wirkungsgrad, der die natürliche Photosynthese von Pflanzen um das Zehnfache übertrifft. Diese Errungenschaft könnte den Weg für eine völlig neue Art der nachhaltigen Energiegewinnung ebnen und dabei gleichzeitig CO2 aus der Atmosphäre binden.
Was ist künstliche Photosynthese?
Künstliche Photosynthese bezeichnet chemische und technische Verfahren, die den natürlichen Prozess der Pflanzen nachahmen. Während Pflanzen Sonnenlicht nutzen, um aus Kohlendioxid und Wasser Zucker und Sauerstoff herzustellen, zielen künstliche Systeme darauf ab, Sonnenenergie direkt in speicherbare chemische Energieträger umzuwandeln. Die Produkte können Wasserstoff, Methanol, Methan oder andere Brennstoffe sein.
Der italienische Chemiker Giacomo Ciamician legte bereits 1912 den gedanklichen Grundstein für diese Technologie. In einer visionären Vorlesung wies er auf die Vorteile der direkten Solarenergienutzung gegenüber der Kohleverbrennung hin. Doch erst 1972 begannen Akira Fujishima und Kenichi Honda ernsthaft damit, diesen Traum technisch umzusetzen.
Die natürliche Photosynthese gilt als der wichtigste biochemische Prozess auf der Erde. Seit drei Milliarden Jahren produzieren Pflanzen, Algen und Cyanobakterien den Sauerstoff, den wir atmen, und die Biomasse, von der wir leben. Allerdings läuft dieser Prozess erstaunlich ineffizient ab – selbst hochproduktive Regenwälder erreichen nur einen Wirkungsgrad von etwa einem Prozent.
Der wissenschaftliche Durchbruch im Detail
Die neue Studie dokumentiert einen beeindruckenden Fortschritt. Bei Labortests mit optimiertem rotem Licht erreichten die künstlichen Systeme einen Nettowirkungsgrad von 30 Prozent. Dieser Wert übertrifft nicht nur die natürliche Photosynthese, sondern kommt auch den besten industriell gefertigten Solarpaneelen nahe, die etwa 20 Prozent Wirkungsgrad erzielen.
Das Geheimnis liegt in der gezielten Optimierung mehrerer Komponenten. Forscher der Technischen Universität München entwickelten ein innovatives „Nanozym“ – ein gelbliches Pulver, das in Wasser aufgelöst und mit Licht bestrahlt wird. Dieses Material wandelt Kohlendioxid in Kohlenmonoxid um und produziert gleichzeitig Wasserstoff. Die beiden Produkte zusammen bilden Synthesegas, einen wertvollen Grundstoff für die chemische Industrie.
Die Innovation besteht in der Verwendung zweier separater Reaktionszentren – eines für Kohlenmonoxid, ein anderes für Wasserstoff. Diese Trennung verhindert unerwünschte Nebenreaktionen und steigert die Gesamteffizienz dramatisch. Ein spezielles Molekül übernimmt dabei die Rolle einer „Energie-Antenne“, ähnlich wie das Chlorophyll-Molekül in Pflanzen.
Vergleich: Künstliche vs. natürliche Photosynthese
Um die Bedeutung dieses Durchbruchs zu verstehen, lohnt sich ein genauer Blick auf die natürliche Photosynthese. Pflanzen erreichen unter realen Bedingungen typischerweise nur 0,5 bis 1,5 Prozent Effizienz. Selbst unter optimalen Laborbedingungen mit perfektem roten Licht kommen sie auf maximal 6,7 Prozent theoretisch und etwa 3 Prozent praktisch.
Warum ist die Natur so ineffizient? Mehrere Faktoren spielen eine Rolle. Das Chlorophyll absorbiert hauptsächlich blaues und rotes Licht, reflektiert aber grüne Wellenlängen – daher die grüne Farbe der Pflanzen. Dadurch nutzen Pflanzen nur etwa 55 Prozent der verfügbaren Sonnenstrahlung.
Zudem kämpfen Pflanzen mit der Photorespiration, einem Prozess, der ihre Effizienz um mindestens 50 Prozent reduziert. Das zentrale Enzym RuBisCO kann nicht perfekt zwischen Kohlendioxid und Sauerstoff unterscheiden. Je höher der Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre, desto häufiger bindet es versehentlich Sauerstoff statt CO2, was zu energieverschwendenden Nebenprozessen führt.
Die künstliche Photosynthese umgeht diese Probleme. Synthetische Katalysatoren können gezielt auf bestimmte Wellenlängen optimiert werden. Sie leiden nicht unter Photorespiration. Und sie können bei Bedarf mit teuren, aber hocheffizienten Materialien arbeiten, die in der Evolution niemals entstehen konnten.
Technologische Ansätze und Materialien
Verschiedene Forschungsgruppen weltweit verfolgen unterschiedliche Ansätze zur künstlichen Photosynthese. Der US-Chemiker Daniel Nocera von der Harvard University entwickelte bereits 2011 ein „künstliches Blatt“. Dabei beschichtete er eine Silizium-Solarzelle mit Kobalt- und Nickel-basierten Katalysatoren. Legt man dieses briefmarkengroße System in Wasser und stellt es in die Sonne, bildet sich Wasserstoff und Sauerstoff.
Das Forschungszentrum Jülich präsentierte ein kompaktes, in sich geschlossenes System zur photoelektrochemischen Wasserspaltung. Anders als bei herkömmlichen Laborexperimenten verbanden die Wissenschaftler alle Komponenten zu einer einzigen Einheit. Der Vorteil: Die Abwärme der Photovoltaikzellen kann direkt für die elektrochemische Wasserspaltung genutzt werden. Zudem kühlt die Wärmeableitung die Solarzellen, was deren Leistung verbessert.
Ein besonders eleganter Ansatz stammt vom Max-Planck-Institut für terrestrische Mikrobiologie in Marburg. Tobias Erb und sein Team entwickelten den CETCH-Zyklus, einen völlig neuartigen Stoffwechselweg zur CO2-Fixierung. Dieser nutzt 17 sorgfältig ausgewählte Enzyme und arbeitet etwa 20 Prozent effizienter als die natürliche Photosynthese-Maschinerie.
Forscher der Johannes Kepler Universität Linz erreichten bei der Bildung des Energiespeicherstoffs NAD(P)H eine maximale Energieausbeute von fast 80 Prozent – doppelt so viel wie das natürliche Photosystem I in Pflanzen. Ihr stabiler Chlorophyll-Ersatzstoff übertrifft das natürliche Vorbild an Langlebigkeit und Effizienz.
Materialwissenschaft: Die Schlüssel zum Erfolg
Die Wahl der richtigen Materialien ist entscheidend für den Erfolg künstlicher Photosynthese. Mehrere vielversprechende Ansätze haben sich herauskristallisiert.
Kohlenstoffnitride haben sich als wirksame Katalysatoren erwiesen. Diese Verbindungen aus Kohlenstoff und Stickstoff spalten mithilfe von Licht Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff. Forschern des Fritz-Haber-Instituts gelang es erstmals, jeden Schritt dieser Reaktion in Echtzeit zu beobachten. Das Kohlenstoffnitrid bildet mit Wasser ein hybrides Halbleitersystem, das die Wassermoleküle destabilisiert und schließlich aufspaltet.
Perowskit-Materialien kommen aus der Photovoltaik-Forschung. Das Lawrence Berkeley National Laboratory kombinierte sie mit nanostrukturierten Kupfer-Elektrokatalysatoren in Form von „Nanoflowers“. Dieses System kann CO2 in wertvolle Kohlenwasserstoffe wie Ethan und Ethylen umwandeln – Grundbausteine für Kraftstoffe und Chemikalien.
Nickel-basierte Elektroden bieten einen kostengünstigen Ersatz für teure Edelmetalle wie Platin und Iridium. Der bisher höchste erreichte Wirkungsgrad von 22,4 Prozent (Stand 2015) wurde mit Nickel-Elektroden erzielt. Nickel ist im Gegensatz zu Platin in großen Mengen verfügbar und erschwinglich.
Organische Farbstoffe ahmen die Lichtabsorption des Chlorophylls nach. Das Team um Frank Würthner von der Universität Würzburg entwickelte gestapelte Perylenbisimid-Moleküle, die Lichtenergie absorbieren und effizient weiterleiten. Solche supramolekularen Strukturen könnten die Grundlage für eine neue Generation photofunktionaler Materialien bilden.
Anwendungsbereiche und wirtschaftliches Potenzial
Die künstliche Photosynthese eröffnet vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, die weit über die reine Energiegewinnung hinausgehen.
Wasserstoffproduktion: Grüner Wasserstoff gilt als Schlüssel zur Energiewende. Künstliche Photosynthese kann Wasser direkt in Wasserstoff und Sauerstoff spalten, ohne den Umweg über Elektrolyse. Die kompakten Anlagen benötigen kein Stromnetz und können dezentral überall dort eingesetzt werden, wo Sonnenlicht verfügbar ist.
Synthetische Kraftstoffe: Aus dem produzierten Wasserstoff und CO2 lassen sich E-Fuels herstellen – klimaneutrale Ersatzstoffe für Benzin, Diesel und Kerosin. Diese könnten den Flug- und Schiffsverkehr dekarbonisieren, Bereiche, in denen Elektrifizierung schwierig ist.
Chemische Grundstoffe: Synthesegas aus Kohlenmonoxid und Wasserstoff ist ein universeller Ausgangsstoff für die chemische Industrie. Methanol, Ethanol, Ethylen und viele andere Verbindungen lassen sich daraus herstellen – bisher meist aus Erdöl und Erdgas.
CO2-Bindung: Besonders attraktiv ist die Möglichkeit, Kohlendioxid direkt aus der Atmosphäre als Rohstoff zu nutzen. Jede Tonne produzierter Kraftstoff oder Chemikalie bindet etwa drei Tonnen CO2. Bei großflächigem Einsatz könnte künstliche Photosynthese zur aktiven Klimagas-Reduktion beitragen.
Lebensmittelproduktion: Ein futuristischer Ansatz nutzt künstliche Photosynthese zur Proteinherstellung. Aus grünem Wasserstoff und CO2 können Aminosäuren synthetisiert werden – ganz ohne landwirtschaftliche Flächen. Die TU München zeigte bereits die Machbarkeit dieses Konzepts.
Herausforderungen auf dem Weg zur Marktreife
Trotz der beeindruckenden Fortschritte bleiben erhebliche Hürden zu überwinden. Die größte Herausforderung ist die Langzeitstabilität der Materialien. Viele synthetische Katalysatoren und Farbstoffe degradieren unter Sonnenlicht und oxidativen Bedingungen. Sie müssen gleichzeitig robust, kostengünstig und hocheffizient sein – eine Kombination, die bisher nicht vollständig gelungen ist.
Die Kosten sind ein weiterer kritischer Faktor. Viele Laborprototypen nutzen teure Edelmetalle wie Platin oder Iridium als Katalysatoren. Iridium ist seltener als Gold, was eine großflächige Anwendung ausschließt. Die natürliche Photosynthese verwendet dagegen das reichlich vorhandene Mangan. Forscher suchen intensiv nach kostengünstigen Alternativen auf Basis häufiger Elemente wie Eisen, Kobalt oder Nickel.
Die Skalierung vom Labor zur industriellen Produktion stellt eigene Anforderungen. Die Liquid Sunlight Alliance (LiSA), eine vom US-Energieministerium finanzierte Initiative, vereint über 100 Wissenschaftler verschiedener Institutionen, um diese Herausforderung anzugehen. Ihr Ziel ist es, Fortschritte bei Solarkraftstoffen durch interdisziplinäre Forschung zu beschleunigen.
Auch die Integration in bestehende Infrastrukturen erfordert Planung. Künstliche Photosynthese-Anlagen benötigen große Flächen mit intensiver Sonneneinstrahlung. Sie konkurrieren dabei nicht mit Landwirtschaft oder Naturschutz, da sie auch auf ungenutzten Flächen wie Wüsten oder Industriebrachen betrieben werden können.
Vergleich mit anderen erneuerbaren Energien
Wie schneidet künstliche Photosynthese im Vergleich mit etablierten Technologien ab? Industriell gefertigte Solarpaneele erreichen etwa 20 Prozent Wirkungsgrad, Laborprototypen kommen auf über 33 Prozent. Windkraftanlagen wandeln bis zu 59 Prozent der Windenergie in Strom um – die theoretische Obergrenze nach dem Betz’schen Gesetz.
Der entscheidende Unterschied: Künstliche Photosynthese produziert direkt speicherbare chemische Energieträger. Photovoltaik liefert Strom, der entweder sofort genutzt oder aufwändig gespeichert werden muss. Batterien sind teuer und haben begrenzte Kapazität. Power-to-Gas-Verfahren, die überschüssigen Solarstrom per Elektrolyse in Wasserstoff umwandeln, erreichen Gesamtwirkungsgrade von etwa 30 bis 40 Prozent.
Die künstliche Photosynthese kann beide Schritte – Lichtabsorption und chemische Umwandlung – in einem einzigen kompakten System integrieren. Sie vermeidet Transportverluste zwischen Solarpark und Elektrolyseur. Und sie nutzt die Abwärme direkt vor Ort, was den Gesamtwirkungsgrad weiter verbessert.
Internationale Forschungslandschaft
Die Forschung zur künstlichen Photosynthese ist ein globales Unterfangen. In Deutschland koordiniert das Forschungsnetzwerk „Solar Technologies go Hybrid“ (SolTech) zahlreiche Projekte. Die Leopoldina, Deutschlands Nationale Akademie der Wissenschaften, veröffentlichte 2018 eine umfassende Stellungnahme zur künstlichen Photosynthese und ihrem Potenzial für das Energie- und Rohstoffsystem.
Das Joint Center for Artificial Photosynthesis am Caltech in Pasadena gilt als weltweit führende Einrichtung. Hier arbeiten Chemiker, Physiker und Ingenieure an der Entwicklung künstlicher Blätter und der Optimierung photokatalytischer Prozesse. Ihre Fortschritte bei Membranen für den Ionentransfer lösten wichtige Probleme früherer Designs.
In Europa fördert das Projekt CataLight mit elf Millionen Euro die Entwicklung von Materialien für künstliche Photosynthese. Unter Leitung der Universitäten Ulm und Jena entwickeln Wissenschaftler molekulare Komponenten, die in weiche Polymermatrizen eingebettet werden – ein Ansatz, der dem natürlichen Vorbild näher kommt als bisherige wässrige Systeme.
Japan investiert erheblich in die Entwicklung künstlicher Photosynthese, angetrieben durch die Erfahrung der Fukushima-Katastrophe und den Wunsch nach Energieunabhängigkeit. Japanische Forscher konzentrieren sich besonders auf die photokatalytische Wasserspaltung mit Titandioxid-basierten Materialien.
Zeitplan und Zukunftsaussichten
Wann wird künstliche Photosynthese im großen Maßstab Realität? Experten schätzen, dass die erste Generation kommerzieller Anlagen in den nächsten fünf bis zehn Jahren umsetzbar ist. Diese werden vermutlich kombinierte Systeme sein, die Photovoltaik mit Elektrolyse koppeln – technisch weniger anspruchsvoll als vollintegrierte künstliche Blätter, aber bereits wirtschaftlich sinnvoll.
Die zweite Generation mit echten künstlichen Blättern wird wohl noch 10 bis 20 Jahre benötigen. Hier müssen zunächst die Materialprobleme gelöst und kostengünstige, stabile Katalysatoren entwickelt werden. Die erreichten 30 Prozent Effizienz sind ein wichtiger Meilenstein, zeigen aber auch, dass weitere Optimierung möglich und nötig ist.
Langfristig könnte künstliche Photosynthese eine Schlüsselrolle in der globalen Energieversorgung spielen. Nach Berechnungen der Leopoldina müssten allerdings enorme Kapazitäten aufgebaut werden, um signifikante Mengen Kraftstoff zu produzieren. Für die Deckung des deutschen Kraftstoffbedarfs wären Anlagenflächen in der Größenordnung von Tausenden Quadratkilometern nötig.
Realistischer ist daher eine Arbeitsteilung: Künstliche Photosynthese in sonnenreichen Regionen wie Nordafrika oder dem Nahen Osten, Export der Produkte in energiehungrige Industrieländer. Ähnlich wie heute Erdöl gehandelt wird, könnten morgen solar produzierte synthetische Kraftstoffe den Weltmarkt beliefern.
FAQ: Häufig gestellte Fragen zur künstlichen Photosynthese
Wie funktioniert künstliche Photosynthese?
Künstliche Photosynthese nutzt synthetische Materialien, um Sonnenlicht zu absorbieren und damit chemische Reaktionen anzutreiben. Typischerweise wird Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten oder CO2 in organische Moleküle umgewandelt. Die Systeme ahmen die natürliche Photosynthese nach, sind aber effizienter.
Warum ist künstliche Photosynthese effizienter als die natürliche?
Pflanzen nutzen nur etwa 55 Prozent des Sonnenlichts und verlieren durch Photorespiration weitere 50 Prozent der Energie. Künstliche Systeme können das gesamte Lichtspektrum nutzen und vermeiden ineffiziente Nebenprozesse. Zudem können sie mit optimierten Katalysatoren arbeiten, die in der Evolution nicht entstanden sind.
Wann wird künstliche Photosynthese kommerziell verfügbar sein?
Erste kommerzielle Anlagen werden in 5 bis 10 Jahren erwartet. Diese werden zunächst Photovoltaik mit Elektrolyse kombinieren. Vollintegrierte künstliche Blätter benötigen wahrscheinlich 10 bis 20 Jahre Entwicklungszeit, bis sie marktreif sind.
Was kostet künstliche Photosynthese?
Aktuelle Laborprototypen sind noch sehr teuer. Für wirtschaftliche Anwendungen müssen die Kosten pro produzierter Energieeinheit unter die von fossilen Brennstoffen fallen. Experten gehen davon aus, dass dies mit Massenproduktion und günstigeren Katalysatoren erreichbar ist.
Kann künstliche Photosynthese die Energiewende ermöglichen?
Sie wird ein wichtiger Baustein sein, aber nicht die alleinige Lösung. Künstliche Photosynthese eignet sich besonders für Bereiche, wo Elektrifizierung schwierig ist – Flugverkehr, Schifffahrt, Chemieindustrie. In Kombination mit anderen erneuerbaren Energien kann sie zur Dekarbonisierung beitragen.
Welche Produkte entstehen bei künstlicher Photosynthese?
Hauptprodukte sind Wasserstoff, Synthesegas (Kohlenmonoxid + Wasserstoff), Methanol, Ethanol und andere Kohlenwasserstoffe. Aus diesen lassen sich Kraftstoffe, Kunststoffe und chemische Grundstoffe herstellen. Als Nebenprodukt entsteht oft Sauerstoff.
Übersicht: Natürliche vs. Künstliche Photosynthese
| Merkmal | Natürliche Photosynthese | Künstliche Photosynthese |
|---|---|---|
| Wirkungsgrad (real) | 0,5-3% | Bis 30% erreicht |
| Wirkungsgrad (theoretisch) | Max. 6,7% | Über 40% möglich |
| Lichtnutzung | Nur 55% (rot/blau) | Gesamtes Spektrum möglich |
| Photorespiration | Ja (-50% Effizienz) | Nein |
| Produkte | Glucose, Sauerstoff | H2, Methanol, Synthesegas |
| Stabilität | Sehr hoch | Noch optimierungsbedürftig |
| Kosten | Minimal (Pflanzen) | Derzeit hoch |
| Entwicklungszeit | 3 Milliarden Jahre | 50 Jahre Forschung |
Die künstliche Photosynthese steht an einem entscheidenden Wendepunkt. Der erreichte Wirkungsgrad von 30 Prozent zeigt, dass die Technologie das Potenzial hat, fossile Brennstoffe zu ersetzen und gleichzeitig CO2 aus der Atmosphäre zu binden. Die kommenden Jahre werden zeigen, ob die verbleibenden technischen und wirtschaftlichen Hürden überwunden werden können.
Was klar ist: Die Natur hat einen faszinierenden Prozess entwickelt, der seit Milliarden Jahren funktioniert. Aber die menschliche Ingenieurskunst kann diesen Prozess optimieren und für neue Zwecke nutzen. Die künstliche Photosynthese könnte der Schlüssel zu einer nachhaltigen, klimaneutralen Zukunft sein.
Weitere Informationen zur Photosynthese finden Sie auf Wikipedia – Künstliche Photosynthese und Wikipedia – Photosynthese.