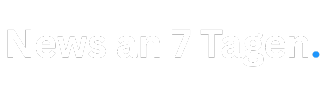Man stelle sich vor: Ein junger Adliger zertrümmert in betrunkenem Übermut Laternen – nur um Jahre später als „Eiserner Kanzler“ die Geschicke Europas zu lenken. So beginnt die Legende eines Mannes, der bis heute polarisiert. War er ein skrupelloser Machtpolitiker oder ein visionärer Reformer? Die Antwort liegt irgendwo dazwischen.
Seine Spuren prägen Deutschland noch heute: Sozialversicherungen, die er einführte, schützen Millionen. Bismarck-Türme ragen in die Landschaft – stumme Zeugen seines Einflusses. Doch hinter der eisernen Fassade verbarg sich ein scharfsinniger Stratege. Mit Tricks wie der Emser Depesche zündelte er diplomatisch – und gewann Kriege, ohne selbst zu schießen.
War er also ein Kriegstreiber oder ein Staatsmann mit Weitblick? Vielleicht beides. Eines ist sicher: Seine Geschichte fesselt noch heute. Wer mehr über den Mann hinter den Widersprüchen erfahren will, findet hier spannende Einblicke.
Einleitung: Wer war Otto von Bismarck?
Sein Name steht für Macht, Widersprüche und ein Erbe, das bis heute nachhallt. Geboren 1815 – im selben Jahr wie der Wiener Kongress – verband er adlige Traditionen mit scharfer Realpolitik. Ein Mann, der Kriege provozierte, aber auch den ersten deutschen Sozialstaat schuf.
Die Bedeutung Bismarcks für die deutsche Geschichte
Ohne ihn gäbe es vielleicht keinen Nationalstaat in heutiger Form. Er vereinte zersplitterte Fürstentümer durch geschickte Diplomatie – und notfalls mit Blut und Eisen. Doch sein Werk war zwiespältig:
- Reichsgründer, der Parlamente verachtete
- Sozialreformer, der Arbeiterparteien verbot
Warum wird er „der eiserne Kanzler“ genannt?
Der Spitzname kam nicht von ungefähr. In seiner berühmten Rede 1862 betonte er: „Nicht durch Reden werden große Fragen entschieden, sondern durch Eisen und Blut.“ Doch privat trank er lieber Wein – den er selbst in Friedrichsruh anbaute.
Historiker streiten noch heute: War sein „Eisern“ ein Zeichen unbeugsamen Willens – oder purer Sturheit? Ein Zitat fasst es zusammen:
„Er war ein Genie der Macht, aber kein Freund der Freiheit.“
Kindheit und Jugend: Die frühen Jahre Bismarcks
Ein Junker-Sohn, der lieber duellierte als lernte – so begann eine Karriere, die Geschichte schrieb. Die Jugendjahre des späteren Reichsgründers lesen sich wie ein Abenteuerroman: voller Widersprüche, scharfer Klingen und durchzechter Nächte.
Geburt und familiärer Hintergrund
Im April 1815 kam er auf Schloss Schönhausen zur Welt – mitten in Europas Umbruchzeit. Die Eltern verkörperten gegensätzliche Welten:
- Der Vater: Ein traditioneller Junker, der militärischen Drill liebte
- Die Mutter: Eine gebildete Bürgerliche mit Hang zu Literatur und Musik
Dieser Mix prägte ihn. Vom Vater übernahm er Standesstolz, von der Mutter geistige Beweglichkeit – auch wenn sie oft aneinandergerieten.
Schulzeit und Studium
Sein Studium in Göttingen glich mehr einem Kneipenmarathon. 25 Duelle, unbezahlte Rechnungen und ein abgebrochenes Referendariat – die Professoren verzweifelten. Doch zwischen Saufgelagen entwickelte er etwas Entscheidendes: Charisma.
Stellen Sie sich vor: Ein 1,90-Meter-Riese mit Fuchsfell-Mütze, der Cicero zitiert – während er Bierkrüge zerschmetterte. So wurde er zur Uni-Legende.
Einfluss der Eltern auf seinen Werdegang
Die Mutter drängte auf Bildung, der Vater auf Pflichtbewusstsein. Beides vereinte er später genial:
| Elterlicher Einfluss | Wirkung auf Bismarck |
|---|---|
| Mütterliche Bildung | Sprachbegabung & diplomatisches Geschick |
| Väterliche Strenge | Disziplin in Krisensituationen |
| Familienstreitigkeiten | Frühes Verständnis für Machtspiele |
Mit 24 Jahren verwaltete er schon Familienländereien – und tilgte nebenbei seine Spielschulden. Ein frühes Training für spätere Staatsgeschäfte.
Bismarcks Weg in die Politik
1848 brannten in Europa die Barrikaden – und er nutzte das Chaos für seinen Aufstieg. Während andere Revolutionäre Freiheit riefen, setzte der spätere Reichskanzler auf Machterhalt. Seine Devise: „Gegen Demokraten helfen nur Soldaten.“ Ein Satz, der sein taktisches Denken verriet.
Erste politische Ämter und Landtagskarriere
Als Mitglied preußischen Landtags lernte er schnell: Worte können wie Waffen sein. Mit der Gründung der Kreuzzeitung 1848 wurde er zum Pressemogul – eine ungewöhnliche Karriere für einen Junker. Die Zeitung war sein Sprachrohr, um konservative Ideen zu verbreiten.
Sein Trick? Konflikte eskalieren lassen, um sie dann für sich zu nutzen. Im Parlament fiel er durch scharfe Reden auf, doch hinter den Kulissen trank er mit Gegnern Wodka – und gewann so Verbündete.
Die Revolution von 1848 und Bismarcks Rolle
Die Revolution 1848 war sein Durchbruch. Während Berlin rebellierte, stand er treu zum König. „Ordnung muss sein“, polterte er – und wurde belohnt. Schon bald vertrat er Preußen im Bundestag.
Eine Anekdote zeigt seinen Stil: Bei Verhandlungen mit Russland servierte er Wodka statt Protokollen. Ergebnis? Vertrauen und spätere Allianzen. Früh zeigte sich: Dieser Mann kannte die Regeln der Macht – und wie man sie bricht.
Bismarcks Aufstieg zur Macht
Ein Mann, der die Regeln der Diplomatie neu schrieb – mit Charme und knallharter Taktik. Sein Weg führte von europäischen Hauptstädten direkt ins Zentrum der preußischen Macht. Dabei setzte er auf eine Mischung aus Brillanz und bewusster Provokation.
Diplomatische Stationen in Frankfurt, St. Petersburg und Paris
In Frankfurt lernte er die Schwächen des Deutschen Bundes kennen – und wie man sie ausnutzt. St. Petersburg wurde zur Schule der russischen Seele: Mit Wodka und Komplimenten gewann er den Zaren für spätere Bündnisse. „Lob ist das billigste Mittel der Politik“, notierte er später.
Paris prägte ihn nachhaltig. Napoleon III. beeindruckte ihn mit moderner Propaganda – eine Lektion, die er nie vergaß. Sein Ziel formulierte er in einer geheimen Denkschrift an Wilhelm I.: „Preußens Grenzen sind nach dem Wiener Vertrag ungesund.“
Ernennung zum preußischen Ministerpräsidenten
1862 stand Preußen am Abgrund – genau sein Moment. Nach einem Badunfall in Biarritz (wo er fast ertrank) kehrte er als Ministerpräsidenten zurück. Seine Methode? Verfassungsbruch als Regierungsinstrument, kombiniert mit bäuerlicher Geradlinigkeit.
Stellen Sie sich vor: Ein Mann, der mit Bauern sprach wie mit Königen – und umgekehrt. Dieses Talent machte ihn unersetzlich. Wilhelm I. sah ihn bald als letzte Option – genau wie geplant.
„Politik ist die Kunst des Möglichen – und manchmal des Unmöglichen.“
„Blut und Eisen“: Bismarcks politische Philosophie
Ein Satz, der Geschichte schrieb und bis heute polarisiert. „Nicht durch Reden werden große Fragen entschieden, sondern durch Eisen und Blut.“ Mit diesen Worten prägte Bismarck 1862 eine Doktrin, die Europa verändern sollte – scharf wie ein Säbelhieb.
Die berühmte Rede und ihre Bedeutung
Was wie blanke Kriegsrhetorik klang, war ein kalkulierter Schachzug. Die Rede vor dem preußischen Landtag war kein Ausrutscher, sondern ein PR-Coup. Er provozierte bewusst – und gewann damit die Gunst des Militärs. „Manchmal muss man Lärm machen, um gehört zu werden“, soll er später gesagt haben.
Doch hinter der martialischen Fassade steckte System. Bismarck nutzte die nationale Begeisterung für Einigung, um seine Ziele zu erreichen. Ein Widerspruch? Vielleicht. Aber einer, der funktionierte.
Krieg als Mittel der Politik
Seine Kriege waren keine blinden Eroberungszüge, sondern „chirurgische Eingriffe“. Kurz, heftig – und mit klarem Ziel: die deutsche Einheit. Eine Anekdote zeigt seinen Pragmatismus: Bei Schlachtplan-Besprechungen markierte er feindliche Stellungen einfach mit Zigarrenasche.
Doch nach 1871 vollzog er einen erstaunlichen Wandel. Plötzlich wurde der Kriegstreiber zum Diplomaten, der Europa friedlich hielt. Ein Paradox? Oder einfach nur Realpolitik in Reinform. Mehr dazu findet sich in der umfassenden Biografie.
„Politik ist die Kunst, das Unvermeidliche so aussehen zu lassen, als wäre es das Gewollte.“
Bismarcks Erbe bleibt zwiespältig: Ein Mann, der Macht mit eiserner Hand ausübte – aber auch wusste, wann sie zu zügeln war. Sein Spiel mit Feuer formte eine Nation – und lehrt uns bis heute, wie gefährlich und genial Politik sein kann.
Die Einigungskriege und die Gründung des Deutschen Reiches

Drei Kriege, ein Reich: So schrieb ein Mann Geschichte mit Waffen und Worten. Hinter den blutigen Schlachten verbarg sich ein geniales Kalkül – jedes Gefecht diente einem größeren Ziel. Die Einigung Deutschlands war kein Zufall, sondern das Ergebnis geschickter Diplomatie und militärischer Präzision.
Der Deutsch-Dänische Krieg (1864)
1864 ging es um Schleswig-Holstein – und um viel mehr. Der Sturm auf die Düppeler Schanzen wurde zur perfekten PR-Show. Zeitungen berichteten begeistert, wie preußische truppen scheinbar uneinnehmbare Festungen nahmen. Ein Meisterstück der Propaganda, das nationale Begeisterung entfachte.
Der Deutsch-Österreichische Krieg (1866)
Bei Königgrätz entschied sich alles in nur sieben Stunden. Der sogenannte „Bruderkrieg“ gegen Österreich war blutig – aber kurz. Bismarcks Ziel: Wien demütigen, ohne es zu zerstören. Ein Balanceakt, der gelang. Die Ironie? Der Sieger trank später mit besiegten Generälen Wein.
Der Deutsch-Französische Krieg (1870-1871)
Frankreich fiel auf eine raffinierte Falle herein. Durch geschickte Manipulation der Emser Depesche provozierte Bismarck Napoleon III. zum Krieg – und gewann Europas Sympathien. Die Kaiserproklamation in Versailles war dann die perfekte Show: ein Reich geboren aus Siegen.
| Krieg | Dauer | Entscheidende Schlacht | Bismarcks Strategie |
|---|---|---|---|
| Deutsch-Dänisch | 1864 | Düppeler Schanzen | Medienwirksame Inszenierung |
| Deutsch-Österreichisch | 7 Wochen | Königgrätz | Schneller Sieg ohne Rache |
| Deutsch-Französisch | 1870-71 | Sedan | Gezielte Provokation |
Amüsant: Der Architekt dieser Kriege hasste Uniformen. „Die Dinger kratzen“, murrte er – und zog lieber zivile Jagdanzüge an. Selbst bei der Kaiserproklamation sah er aus wie ein verschlafener Landjunker. Doch genau diese Unkonventionalität machte ihn so gefährlich – und erfolgreich.
„In der Politik muss man oft Salz in die Wunde streuen, damit der Gegner laut schreit – und alle hören warum.“
Die Proklamation des Deutschen Kaiserreichs 1871
18. Januar 1871: Ein Datum, das Geschichte atmet – und französischen Marmor erzittern ließ. Im Spiegelsaal von Versailles, wo einst Ludwig XIV. prunkte, krönte sich Preußens König zum Deutschen Kaiser. Die Botschaft war klar: Deutschlands Einheit besiegelte Frankreichs Niederlage. Doch hinter den Goldstickereien brodelte ein diplomatisches Pokerface.
Ein Theater der Macht
Die Kaiserproklamation war inszeniert wie eine Oper – mit unerwarteten Pannen. Wilhelm I. sträubte sich gegen den Titel: „Kaiser von Deutschland? Ich bin doch preußischer König!“ Sein Zorn soll so heftig gewesen sein, dass er die Krone fast einem bayerischen Prinzen anbot. Ein diplomatisches Desaster – verhindert nur durch geschicktes Lavieren.
Doch der Spiegelsaal war perfekt gewählt. Jeder Kristallleuchter spiegelte französische Demut. Während draußen Soldatenfriedhöfe wuchsen, zelebrierte man innen Einheit. Eine bittere Ironie: Ausgerechnet hier, wo Frankreich einst seinen Glanz feierte, wurde sein Rivale geboren.
Der Architekt im Hintergrund
Als erster Reichskanzler baute er geschickt Scheindemokratien ein. Der Bundesrat? Ein Papiertiger, der Fürsten beruhigte. Seine wahre Macht lag woanders: im Vertrauen des Kaisers und einem Netz aus Geheimabsprachen. Vom einstigen Außenseiter war er zum Strippenzieher aufgestiegen – und genoss es sichtlich.
Sein größter Coup: Die Verfassung gab dem Volk Gefühle von Mitbestimmung – ohne reale Macht. Ein Kommentar eines Abgeordneten brachte es auf den Punkt: „Wir applaudieren, während er die Fäden zieht.“
| Symbol | Bedeutung | Realität |
|---|---|---|
| Spiegelsaal | Deutsche Einheit | Französische Demütigung |
| Kaiserkrone | Nationale Stärke | Persönliche Widerstände |
| Bundesrat | Föderalismus | Gesteuerte Scheindemokratie |
„Manchmal muss man die Wahrheit vergolden, damit sie die Leute schlucken.“
Innenpolitische Herausforderungen: Kulturkampf und Sozialistengesetze
1.300 Priester inhaftiert oder ausgewiesen – so begann ein Machtspiel, das die Nation spaltete. Während das Reich nach außen stark wirkte, kämpfte der Kanzler innen gegen Feinde von links und rechts. Ein Paradox: Der Mann, der Deutschland einte, provozierte gezielt Konflikte im eigenen Land.
Der Konflikt mit der katholischen Kirche
Sein Kulturkampf war kein Glaubenskrieg, sondern Machtpolitik. Katholiken verdächtigte er, dem Papst mehr zu gehorchen als Berlin. Die Folge: Klöster schlossen, Bischöfe flohen. Doch der Plan ging nicht auf. Statt zu brechen, wuchs der Widerstand – besonders im Süden.
Amüsant: Ausgerechnet der erzkonservative Kanzler bekämpfte die Kirche. Warum? „Einheit braucht einen Feind“, soll er gesagt haben. Doch die Kosten waren hoch: Über 1.300 Geistliche verloren ihre Ämter. Ein Pyrrhussieg.
Die Unterdrückung der Sozialdemokraten
1878 verbot er die SPD – und trieb sie damit erst recht in die Illegalität. Ironie der Geschichte: Ausgerechnet Bismarck-Gegner finanzierten nun die Sozialisten heimlich. Die Partei wuchs trotz Verbot. Sein Spitzel? Ein Postbote, der beim Flugblattvertehen ertappt wurde. Peinlich!
| Maßnahme | Ziel | Resultat |
|---|---|---|
| Sozialistengesetze | SPD zerschlagen | Wachstum im Untergrund |
| Geheimfonds | Spitzel finanzieren | Lächerliche Aufdeckungen |
| Pressezensur | Kritik ersticken | Flugblätter statt Zeitungen |
„Verbotene Früchte schmecken süßer – besonders wenn der Verbieter selbst sie pflückt.“
Langfristig entfremdete er damit die Arbeiterschaft. Ein Fehler, der später teuer wurde. Doch in den 1880ern zählte nur eins: Kontrolle. Selbst wenn sie nur auf dem Papier stand.
Sozialreformen: Bismarcks progressive Seite
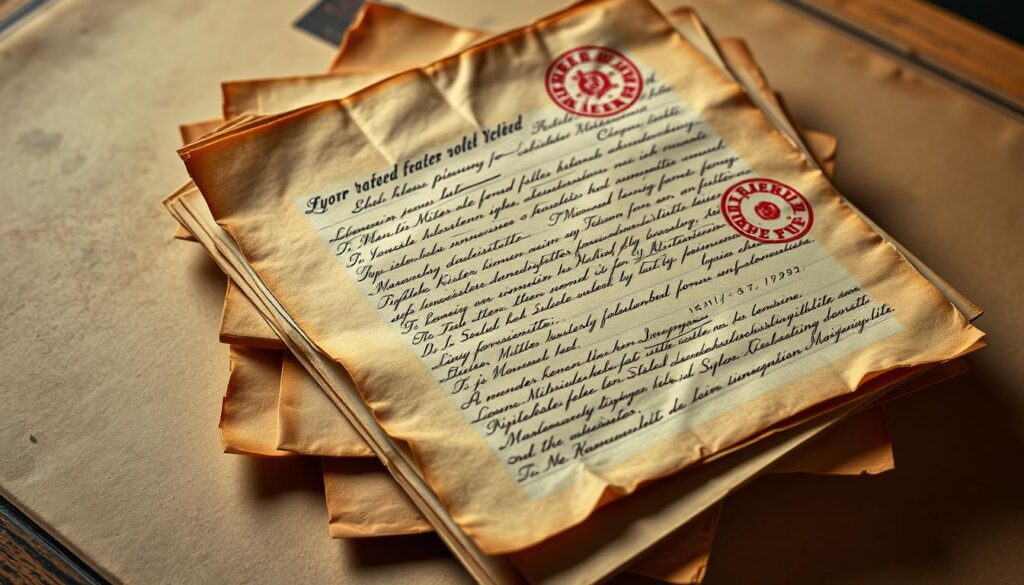
Ausgerechnet der Mann, der mit „Blut und Eisen“ drohte, schuf den Grundstein für den modernen Sozialstaat. Während er politische Gegner bekämpfte, webte er ein Sicherheitsnetz für Millionen Arbeiter. Ein Widerspruch? Nur auf den ersten Blick.
Ein revolutionäres Paket
1883 startete die krankenversicherung – weltweit das erste umfassende System. Arbeitgeber und Staat teilten die Kosten. Der wahre Grund? „Eine Revolution ist teurer als Sozialhilfe“, soll Bismarck gesagt haben. Zynisch, aber effektiv.
Stellen Sie sich vor: Ein Kanzler, der selbst Ärzte mied, garantierte plötzlich medizinische Versorgung. Die Ironie war ihm bewusst. Trotzdem funktionierte es. Handwerker profitierten zuerst, Fabrikarbeiter folgten.
Sicherheit von der Wiege bis zur Bahre
1884 kam die Unfallversicherung, 1889 die rentenversicherung. Das Prinzip war genial einfach:
- Beiträge während der Arbeitsjahre
- Leistungen bei Krankheit oder Alter
- Staatliche Garantie als Rückhalt
Europas Monarchien staunten. Ausgerechnet Deutschland, kein Musterland der Demokratie, wurde zum Sozialpionier. Ein Modell, das bis heute nachwirkt – trotz aller Reformen.
„Man kann die Leute nicht mit Kanonen füttern – aber mit Renten beruhigen.“
Das größte Paradox? Der Erfinder dieser Reformen hasste Demokratie. Doch sein Werk überdauerte alle Kaiser – und prägt unser Leben bis heute.
Bismarcks Außenpolitik: Friedenssicherung in Europa
Diplomatie war sein Spielbrett – und Europa die Figuren. Nach den Einigungskriegen vollzog der Reichskanzler einen erstaunlichen Wandel: Vom Kriegstreiber zum Friedensstifter. Seine Methode? „Man muss fünf Eisen im Feuer haben – und keines glühen lassen.“
Bündnissysteme als Sicherheitsnetz
Sein Bündnisfalle-System funktionierte wie ein diplomatisches Mobile: Jeder Zug musste ausbalanciert sein. 1873 band er Russland und Österreich an Deutschland – doch heimlich. „Verträge sind wie Damenunterwäsche: Sie wirken am besten, wenn man sie nicht zeigt“, scherzte er.
Stellen Sie sich vor: Bei einem Treffen mit Zar Alexander II. tranken sie Wodka aus Bierkrügen – und besiegelten so eine Allianz. Diese unkonventionelle Art machte ihn zum gefürchteten Strategen.
Kolonialpolitik: Zögerlicher Weltmacht-Traum
Bis 1884 lehnte er Kolonien ab: „Kanonenfieber bringt nur Kopfschmerzen.“ Doch dann erwarb Deutschland doch Gebiete – sogar Samoa. Warum? Ein Handelskonzern bat um Schutz, und der Kanzler winkte durch. Pragmatismus pur.
| Jahr | Bündnis | Ziel | Trick |
|---|---|---|---|
| 1873 | Dreikaiserabkommen | Isolation Frankreichs | Geheime Zusatzklauseln |
| 1879 | Zweibund mit Österreich | Ostgrenzen sichern | Rhetorische Nebelkerzen |
| 1887 | Rückversicherungsvertrag | Russland binden | Doppelzüngige Versprechen |
„Die Kunst ist, alle staaten im Glauben zu lassen, man sei ihr bester Freund – während man selbst keinen hat.“
Sein Vermächtnis? 20 Friedensjahre in Europa – nach drei blutigen Kriegen. Ein Balanceakt zwischen Drohung und Charme, der bis heute beeindruckt. Oder wie ein Zeitgenosse sagte: „Er jonglierte mit Dynamit – und ließ nie etwas fallen.“
Das Ende der Ära Bismarck
1890 endete eine Ära, die Deutschland geprägt hatte – mit Milchkannen und Memoiren. Nach 28 Jahren an der Macht verließ der Reichskanzler die Bühne. Nicht freiwillig, sondern weil ein junger Kaiser meinte, es besser zu wissen. Die Szene wirkt wie aus einem Theaterstück: Staatsakten, heimlich in Milchkannen abtransportiert.
Stellen Sie sich vor: Ein 75-Jähriger, der halb Europa lenkte, wird von einem 29-jährigen Monarchen entlassen. Wilhelm II. wollte keinen Mentor – sondern Bewunderung. Der Konflikt war vorprogrammiert. „Majestät, gegen Demokraten helfen nur Soldaten“, raunzte der alte Fuchs – doch der Kaiser hörte nicht mehr.
Ein Machtkampf mit fünf Akten
Das Drama zog sich über Monate. Fünfmal bot der Kanzler seinen Rücktritt an – jedes Mal ein taktisches Manöver. Doch beim letzten Mal nahm der Kaiser ihn beim Wort. Die Entlassungsurkunde kam per Bote, ohne persönliches Gespräch. Ein Affront für den erfahrenen Diplomaten.
Die Presse karikierte ihn als „Lotse, der von Bord geht“. Ironisch, denn gerade hatte er noch gewarnt: „Jetzt geht’s die Bergstraße runter.“ Seine Prophezeiung sollte sich bald erfüllen.
Posthume Rache eines Staatsmannes
Seine Rache war ebenso genial wie bissig: Die Memoiren „Gedanken und Erinnerungen“ wurden zum Bestseller. Darin beschrieb er den Kaiser als unerfahrenen Hasardeur. Das Volk liebte diese Enthüllungen – der Hof nicht.
„Die Jugend denkt, sie könne Treppen mit einem Satz nehmen – und merkt nicht, dass jede Stufe einzeln erklommen werden muss.“
Sein letzter Tag im Amt zeigt den ganzen Bismarck: Während Diener Akten fortschafften, trank er seelenruhig Wein – und diktierte nebenbei boshafte Briefe. Ein Abgang mit Stil, der bis heute fasziniert.
Bismarcks letzte Jahre und Tod
Vom Spiegelsaal in Versailles zum beschaulichen Gutshaus – Bismarcks letzte Jahre waren voller Kontraste. Der Mann, der einst mit Königen pokerte, verbrachte seine Tage nun mit Baumfällen und scharfzüngigen Memoiren. Eine ironische Wendung für den Architekten des Reiches.
Leben in Friedrichsruh
Sein Gut in Friedrichsruh wurde zur Therapiestätte. Täglich fällte der Ex-Kanzler Bäume – angeblich gegen Wutanfälle. „Holzhacken ist die beste Medizin gegen Minister“, scherzte er. Doch hinter der rustikalen Fassade arbeitete ein scharfer Geist.
Journalisten pilgerten zu ihm wie zu einem Orakel. Bei dreistündigen Interview-Marathons rauchte er Zigarren und kritisierte den Kaiser. Einmal empfing er Reporter im Jagdanzug – mit Axt in der Hand. Die Presse liebte diese Show.
Sein Vermächtnis und die öffentliche Wahrnehmung
1895 erreichten ihn 500.000 Geburtstagsglückwünsche. Bis 1914 entstanden 700 Denkmäler – mehr als für jeden anderen Deutschen. Der Kult war allgegenwärtig:
- Bismarck-Bier in Hamburg
- Bismarck-Hering in Konserven
- Sogar ein Bismarck-Eis in Berlin
Doch sein Tod 1898 nährte Mythen. Angeblich flüsterte er noch: „Russland… nie provozieren.“ Ein prophetischer Rat, den Wilhelm II. ignorierte.
„Denkmäler sind wie Grabsteine – sie halten die Toten gefangen, statt sie zu ehren.“
Heute ist das Erbe zwiespältig. Manche Städte entfernen seine Statuen, andere restaurieren sie. Eines bleibt: Kein Deutscher polarisiert 125 Jahre nach seinem Tod noch so sehr wie der „Eiserne Kanzler“.
Fazit: Bismarcks widersprüchliches Erbe
Deutschlands Einheit verdankt ihm viel – doch zu welchem Ziel? Der Architekt der Nation schuf einen Staat mit zwei Gesichtern: sozialer Fortschritt neben eiserner Unterdrückung.
Sein Paradox? Ein Modernisierer, der Parlamente verachtete. Ein Stratege, der Kriege führte – nur um dann Europa friedlich zu halten. „Realpolitik über Moral“, lautete sein Mantra. Bis heute streiten Historiker: War das Genie oder Tyrannei?
Selbst 1945, im Führerbunker, soll sein Geist beschworen worden sein – als Warnung vor Macht ohne Maß. Eine groteske Anekdote, die sein zwiespältiges Image unterstreicht.
Braucht Deutschland heute wieder einen „eisernen Kanzler“? Oder ist sein widersprüchliches Erbe Mahnung genug? Die Antwort liegt vielleicht in seiner eigenen Maxime: „Politik ist die Kunst des Möglichen – nicht des Wünschenswerten.“