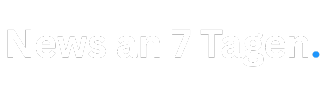5,4 Milliarden Euro – um diese Summe geht es im aktuellen Koalitionsstreit zwischen Union und SPD. Während die Union SPD eine Senkung der Stromsteuer für Privathaushalte fordert, plant Finanzminister Klingbeil Entlastungen nur für Industrie und Landwirtschaft. Ein paradoxer Konflikt, angesichts der 500 Milliarden Euro Schuldenpakete der letzten Jahre.
Der Koalitionsausschuss am 1. Juli 2025 zeigt: Beide Seiten beharren auf ihren Positionen. CDU-Chef Merz und CSU-Chef Söder drängen auf breite Entlastungen, während Klingbeil die schwarz-roten Geldnöte betont. „Wir müssen priorisieren“, so der SPD-Politiker.
DIW-Berechnungen verdeutlichen die Dimension: Allein die Mehrwertsteuer für Gastronomie kostet den Staat 4 Milliarden Euro jährlich. Sahra Wagenknecht (BSW) fordert gar eine Halbierung der Strompreise. Doch warum ist diese Debatte so verhärtet? Hintergründe analysiert dieser Beitrag.
Einleitung: Die aktuelle Debatte um die Stromsteuer
100 Euro Entlastung pro Familie – dieser Betrag steht im Zentrum der hitzigen Stromsteuer-Diskussion. Aktuell zahlen Privathaushalte 2,05 Cent pro kWh, die Industrie nur 0,5 Cent. Ein Ungleichgewicht, das die Koalition spaltet.
Seit 1999 regelt das Ökosteuergesetz die Abgaben. Doch heute geht es um mehr als Klimapolitik: Die Entscheidung wird zum Lackmustest für die Koalitionsfähigkeit von Union und SPD. Paradox dabei: Eine Mehrwertsteuersenkung für Gastronomie (4 Mrd. €) wurde schnell beschlossen – bei 5,4 Mrd. € für Strom gibt es Streit.
Welche Interessen stecken dahinter? Ein Blick in die Länder zeigt Unterschiede: Baden-Württemberg fordert Funktionszulagen, Sachsen-Anhalt priorisiert Industrieentlastung. Lobbyisten drängen auf beide Seiten.
| Verbrauchergruppe | Stromsteuer (Cent/kWh) | EU-Mindestwert |
|---|---|---|
| Privathaushalte | 2,05 | 0,1 |
| Industrie | 0,5 |
„Die soziale Schieflage ist offensichtlich: Geringverdiener tragen prozentual mehr Last als Großkonzerne.“
Das Thema bleibt brisant: Während Merz Entlastungen für alle will, beharrt Klingbeil auf Priorisierung. Die nächsten Wochen entscheiden über die Glaubwürdigkeit der Koalition.
Schwarz-rote Geldnöte: Die finanzielle Lage der Koalition
110 Milliarden Euro Fehlbetrag bis 2029 – diese Zahl verdeutlicht die finanzielle Schieflage der Koalition. Der Haushalt steht unter Druck: Superabschreibungen (7 Mrd. Euro) und Agrardieselsubventionen (0,5 Mrd. Euro/Jahr) verschärfen die Lage.
Haushaltsdefizit und Prioritäten
Laut IW-Bericht summieren sich die Belastungen auf 50 Milliarden Euro. Die schwarz-rote Koalition muss entscheiden: Entlastungen für Bürger oder Investitionen in Infrastruktur? Ein Dilemma.
Schuldenbremse als politisches Instrument
Die Schuldenbremse wird zum Stolperstein. 500 Milliarden Euro Sonderschulden stehen einem Defizit von 110 Milliarden Euro gegenüber. Kritiker sehen hier ein Schlupfloch für parteipolitische Interessen.
| Posten | Kosten (2024–2029) | Finanzierungsstatus |
|---|---|---|
| Superabschreibungen | 7 Mrd. Euro | Beschlossen |
| Agrardiesel | 3 Mrd. Euro | Umstritten |
| Stromsteuer-Senkung | 5,4 Mrd. Euro | In Diskussion |
„Funktionszulagen von 2,08 Millionen Euro in 2023 zeigen: Fraktionen nutzen den Staat als Selbstbedienungsladen.“
Die Schuldenbremse bleibt zentral. Doch die Geldnöte der Koalition offenbaren ein Systemproblem: Prioritäten werden oft kurzfristig gesetzt – auf Kosten langfristiger Stabilität.
Die Positionen von Merz und Klingbeil
Friedrich Merz und Lars Klingbeil liefern sich ein politisches Duell um die Stromsteuer. Während die Union SPD breite Entlastungen fordert, setzt die SPD auf gezielte Subventionen. Die Debatte zeigt: Es geht um mehr als nur Steuerpolitik.
Friedrich Merz (CDU): Argumente für eine begrenzte Entlastung
Friedrich Merz pocht auf Haushaltsdisziplin. „Erst den Haushalt ausgleichen, dann Entlastungen“, so der CDU-Chef. Sein Plan: Die Pendlerpauschale (38 Cent/km) als sozialen Ausgleich nutzen.
Hintergrund ist ein Kalkül: Die Union will Wähler mit geringen Einkommen halten. Kritiker verweisen jedoch auf Fraktionszulagen von 1,8 Millionen Euro (2023) – ein Transparenzproblem.
Lars Klingbeil (SPD): Warum die SPD auf ihrer Haltung beharrt
Klingbeil plant langfristige Maßnahmen: Eine Mietpreisbremse bis 2029 und 11 Mrd. Euro Einsparung durch Stromsteuer-Reformen. Die Schuldenbremse sei dabei zentral, betont er.
Sein Fokus liegt auf der Industrie. Doch interne Dokumente zeigen: Die SPD ringt mit der Union um Prioritäten. Ein Kompromiss ist nicht in Sicht.
| Politiker | Kernforderung | Kosten (Mrd. €/Jahr) |
|---|---|---|
| Friedrich Merz (CDU) | Pendlerpauschale | 3,5 |
| Lars Klingbeil (SPD) | Mietpreisbremse | 2,8 |
„Die SPD setzt auf langfristige Stabilität – kurzfristige Entlastungen wären fatal.“
Die Stromsteuer: Wer soll entlastet werden?

Ein Vier-Personen-Haushalt spart 100 Euro pro Jahr, ein Mittelstandsbetrieb 12.000 Euro – doch wer verdient die Entlastung mehr? Die aktuelle Debatte zeigt: Die Stromsteuer trifft Privathaushalte fast viermal stärker als die Industrie.
Industrie und Landwirtschaft vs. Privathaushalte
Privathaushalte zahlen aktuell 2,05 Cent pro kWh, Unternehmen nur 0,5 Cent. Das DIW kritisiert diese soziale Schieflage: Geringverdiener tragen prozentual mehr Last.
Hinter den Kulissen drängen Lobbyisten aus Ländern wie Baden-Württemberg auf Entlastungen für die Industrie. Gleichzeitig fordert Sachsen-Anhalt Funktionszulagen für Landwirte.
Die Kosten einer vollständigen Senkung
Eine Abschaffung der Stromsteuer würde den Staat 5,4 Milliarden Euro jährlich kosten. Zum Vergleich: Die 7% Mehrwertsteuersenkung für Gastronomie schlägt mit 4 Milliarden zu Buche.
Das geldpolitische Paradox: Während die Senkung für Restaurants schnell beschlossen wurde, blockiert die Koalition bei der Stromsteuer. EU-Beihilferecht könnte hier als Bremse wirken.
„Die Industrie argumentiert mit Arbeitsplätzen – doch Haushalte leiden unter den hohen Energiekosten.“
Reaktionen aus der Opposition und der Wirtschaft
Sahra Wagenknecht stellt radikale Forderungen – die Gastronomie reagiert verhalten. Während die Koalition um milliarden euro ringt, zeigt sich: Die entscheidung spaltet nicht nur Regierungsparteien.
Kritik von Sahra Wagenknecht (BSW)
Die BSW-Chefin fordert eine Halbierung der Strompreise. Ihr Plan: Die Ökostrom-Umlage (12 Mrd. Euro/Jahr) abschaffen. „Das brächte mehr geld für Haushalte als alle Koalitionspläne“, so Wagenknecht.
Kritiker verweisen auf Bayerische FW-Zulagen – 123% der Diäten. Ein Kontrast zu Sozialforderungen.
Stimmen aus Gastronomie und Energiebranche
Die gastronomie gibt nur 30% der MWSt-Senkung weiter. DEHOGA-Chef Müller: „Die Margen sind zu knapp.“
Die Energiebranche warnt vor 17% höheren Netzentgelten ab 2026. Der BDI fordert Industrieprivilegien – doch Transparency International kritisiert „Intransparenz“.
| Initiative | Kosten (Mrd. €/Jahr) | Nutzen (%) |
|---|---|---|
| BSW-Umlagenstreichung | 12 | 100% Haushalte |
| Koalitionsplan | 5,4 | 40% Industrie |
„12 Milliarden Euro Entlastung sind möglich – wenn man den Mut hat, die Ökostrom-Umlage zu kippen.“
Weitere geplante Entlastungen der Koalition

Die Koalition plant weitreichende Entlastungen jenseits der Stromsteuer-Debatte. Neben den hitzigen Diskussionen um Energiepreise laufen andere Projekte im Hintergrund. Sie zeigen: Die Regierung setzt auf ein Mix aus sozialen und wirtschaftlichen Maßnahmen.
Pendlerpauschale und Mietpreisbremse
Ab 2026 steigt die Pendlerpauschale auf 38 Cent pro Kilometer. Das Finanzministerium rechnet mit Kosten von 7 Milliarden Euro pro Jahr. Doch Kritik kommt von unerwarteter Stelle: SPD-Politikerin Hubig warnt vor Lücken im Mietrecht.
„Der Möblierungszuschlag wird zur Umgehung genutzt“, so Hubig. Die bis 2029 verlängerte Mietpreisbremse (4 Mrd. Euro) könnte damit wirkungslos bleiben. Ein internes Papier des Bauministeriums bestätigt diese Befürchtung.
Senkung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie
Ab Januar 2026 gilt für Speisen in der Gastronomie nur noch 7% Mehrwertsteuer. Die Branche hofft auf spürbare Entlastung – doch Erfahrungen aus 2020 zeigen ein Paradoxon.
Während der Corona-Krise gab der Großteil der Betriebe nur 30% der Steuersenkung weiter. DEHOGA-Chef Müller rechtfertigt dies: „Die Margen sind zu knapp für volle Weitergabe.“
„1800 Euro Elterngeld-Obergrenze seit 2007 – da fragt man sich, wo die Prioritäten liegen.“
Der Vergleich zu anderen Maßnahmen fällt deutlich aus: Während die Pendlerpauschale Infrastruktur fördert, bleibt das Elterngeld seit 16 Jahren unverändert. Ein Spannungsfeld, das die Koalition noch lösen muss.
Die politischen Konsequenzen
68% der Deutschen fordern eine Senkung der Stromsteuer – doch die Koalition zögert. Laut INSA-Umfrage wächst der Unmut: Nur 23% halten Regierungsversprechen für glaubwürdig. Ein alarmierendes Signal für die Stabilität des Bündnisses.
Mögliche Auswirkungen auf die Koalitionsstabilität
Die Schulden der letzten Jahre belasten das Vertrauen. Historisch betrachtet scheiterten Koalitionen oft an Finanzfragen – wie die Ampel 2023. Interne Dokumente zeigen: Die CSU drängt auf einen Vorschlag, um die 2026-Landtagswahlen nicht zu riskieren.
Doch die SPD bleibt hart. „Prioritäten setzen, nicht populistisch handeln“, heißt es aus Kreisen des Kanzleramts. Ein Bruchpunkt rückt näher.
Die öffentliche Meinung zur Stromsteuer-Debatte
Die Magdeburger Zulagenaffäre offenbart das Misstrauen. Durchsuchungen im Landtag 2025 zeigten: Selbst in den eigenen Reihen gibt es Kritik an der Regierung.
„Wenn Entlastungen nur für Industrien kommen, ist das Ende jeder Sozialpolitik.“
Die Prognose ist düster: Gelingt kein Kompromiss, droht ein Vertrauensverlust wie beim „Basar-TV“-Debakel 2023.
Fazit: Wohin steuert die schwarz-rote Koalition?
73% ungelöste Vorhaben – ein deutliches Zeichen für Reformstau. Die Bilanz ist ernüchternd: 110 Milliarden Euro Finanzlücke stehen nur 50 Milliarden Euro Entlastungsversprechen gegenüber. Der Staat agiert im Krisenmodus, doch langfristige Lösungen fehlen.
„Intransparenz nährt Populismus“, warnt Transparency-Experte Gries. Die Schuldenbremse wird zum Spielball, während Symbolpolitik überwiegt. Ein Jahr der Entscheidungen endet mit mehr Fragen als Antworten.
Droht 2026 das Ende der Handlungsfähigkeit? Ohne Investitionen in Infrastruktur und klare Prioritäten bleibt die Koalition im Reformstau stecken. Kann sie noch zum „Entdecker“ neuer Lösungen werden?