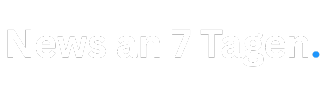Vor fast 100 Jahren revolutionierte eine technische Neuheit den Alltag der Kölner: Am 11. Juli 1925 wurde im Kaufhaus Tietz Köln die erste Rolltreppe Deutschlands eingeweiht. Was heute selbstverständlich ist, galt damals als Sensation – ein Meilenstein der Konsumarchitektur.
Eine historische Postkarte im Kölnische Stadtmuseum zeigt die schmale Anlage mit drei Personen. Der Werbeslogan „Roll-Fußsteige sparen Zeit und Geld“ verdeutlicht, wie fortschrittlich das Projekt wirkte. Die Rolltreppe stand symbolisch für den rasanten Wandel der Zeit.
Das Kaufhaus Tietz setzte damit Maßstäbe. Parallel prägten Urbanisierung und Modernisierung das Stadtbild. Köln wurde zum Schauplatz einer neuen Ära – nicht nur im Handel, sondern auch im täglichen Leben.
Die erste Rolltreppe Deutschlands: Ein historischer Meilenstein
1925 markierte einen Wendepunkt in der deutschen Handelsgeschichte. Im Kaufhaus Tietz wurde nicht nur eine technische Neuheit eingeführt – sie wurde zum Symbol des Fortschritts. Zeitgenossen sprachen von einer „Rückkehr der Zukunft“.
Die Eröffnung im Kaufhaus Tietz 1925
Die Anlage war schmal und benötigte Assistenzpersonal, sogenannte Liftboys. Diese halfen den Kunden beim Betreten der Roll-Fußsteige. Technische Dokumente zeigen: Die Geschwindigkeit lag bei 0,3 m/s – heute ein Bruchteil moderner Systeme.
Werbung und Akzeptanz der „Roll-Fußsteige“
Anfangs herrschte Skepsis. Werbematerialien betonten:
„Zeitersparnis und Komfort für alle.“
Archivfotos belegen, wie Besucher die Technik zunächst misstrauisch beäugten. Innerhalb einesJahresstieg die Nutzung jedoch stark an.
Schnelle Verbreitung in Berlin und München
Berlin München folgten Kölns Beispiel noch 1925. In Berlin kamen spezielle Begleiter zum Einsatz, während München auf breitere Konstruktionen setzte. Die Städte konkurrierten um die modernste Lösung – ein Wettlauf der Innovationen.
Von New York nach Köln: Die technische Revolution

Die technische Revolution der Rolltreppe begann nicht in Köln, sondern auf der anderen Seite des Atlantiks. Jesse W. Reno, ein US-amerikanischer Ingenieur, meldete bereits 1892 ein Patent für seine Erfindung an. Seine Vision: Menschen mühelos durch Gebäude und öffentliche Räume bewegen.
Jesse W. Renos Patent und die Ursprünge in den USA
Die Patentnummer 470.918 dokumentiert Renos bahnbrechende Idee. Erstmals eingesetzt wurde die Anlage 1896 im Vergnügungspark Coney Island in New York. Dort diente sie als Attraktion – Besucher zahlten Eintritt, um das „magische“ Transportmittel zu erleben.
Reno selbst stand oft persönlich vor Ort und erklärte die Technik. Sein System war einfacher als heutige Modelle, aber der Grundgedanke blieb derselbe: Komfort und Effizienz.
Vom Vergnügungspark zum urbanen Alltag
Was als Touristenhighlight begann, wurde schnell zum urbanen Standard. Kaufhäuser in New York erkannten das Potenzial. Bis 1925 hatte sich die Technik soweit weiterentwickelt, dass sie auch in Europa Fuß fasste.
In Köln setzte man auf bewährte Technik – doch die Sicherheitsstandards waren 1925 noch längst nicht so hoch wie heute. Liftboys halfen den Kunden, Unfälle zu vermeiden.
Moderne Zahlen: 39.000 Rolltreppen in Deutschland heute
Laut VDMA gibt es aktuell rund 39.000 Rolltreppen in Deutschland. Moderne Anlagen sind breiter, schneller und sicherer. Störfälle sind selten, dank regelmäßiger Wartung.
Ein Vergleich: Während die Anlage im Kaufhaus Tietz 0,3 m/s schaffte, erreichen heutige Modelle bis zu 0,75 m/s. Ein deutlicher Fortschritt – doch die Faszination bleibt.
Kultur und Gesellschaft: Die Rolltreppe als Symbol

Kulturhistoriker sehen in der Rolltreppe mehr als nur ein Transportmittel. Sie steht für Fortschritt, Urbanisierung und sogar soziale Hierarchien. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie zum Symbol des Wirtschaftswunders – ein Zeichen für Wiederaufbau und Modernität.
Wirtschaftswunder und Konsumgesellschaft
In den 1950er Jahren verkörperten Rolltreppen den neuen Wohlstand. Warenhäuser wie das Kaufhaus Tietz nutzten sie als Marketingtool. Studien zeigen: Kunden assoziierten die Technik mit Luxus – wer sie nutzte, gehörte dazu.
Zeitzeugen berichten von langen Schlangen. Die Rolltreppe war nicht nur praktisch, sondern auch ein Statussymbol. Dieses Phänomen prägte die Konsumgesellschaft der Nachkriegszeit.
Reinhard Meys Kindheitserinnerungen
Der Liedermacher Reinhard Mey beschreibt in *Sei wachsam* eine besondere Faszination:
„Im Kaufhaus stundenlang Rolltreppe fahren.“
Sein Zitat spiegelt die kindliche Begeisterung für die technische Neuheit wider.
Mey erinnert sich an eine Zeit, in der Rolltreppen noch Abenteuer versprachen. Heute sind sie Alltag – doch ihre kulturelle Bedeutung bleibt.
Literarische und filmische Rezeption
Hans-Georg Noacks Roman Rolltreppe abwärts (1970) thematisierte soziale Abwärtsbewegungen. Das Buch wurde zur Schullektüre und prägte eine Generation.
In Hollywood filmen wie Skyfall oder Final Destination wird die Rolltreppe zum dramatischen Schauplatz. James Bonds Stunt im Londoner U-Bahn-System zeigt: Die Technik inspiriert bis heute.
Mehr über die 100 Jahre Rolltreppe verrät das Kölnische Stadtmuseum.
Fazit: 100 Jahre Fortschritt und Faszination
Ein Jahrhundert technischer Evolution zeigt: Bewegliche Treppen prägen Städte weltweit. Projekte wie Comuna 13 in Medellín – mit 384 Metern Länge – nutzen sie heute für *soziale Mobilität*. Was 1925 in Köln begann, ist globaler Standard.
Aktuelle Forschung treibt die Entwicklung voran. Solarbetriebene Modelle und Studien zur Akzeptanz bei Senioren stehen im Fokus. Doch Fragen bleiben: Wie vereint man Barrierefreiheit mit Nachhaltigkeit?
2025 jährt sich die Einweihung zum 100. Mal. Ein Anlass, um über Zukunftstechnologien zu diskutieren. Automatisierte Systeme könnten die nächste Revolution sein – doch die Faszination der ursprünglichen Idee bleibt.