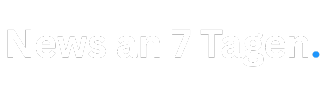Über 70 Millionen elektronische Patientenakten wurden bereits vergeben, doch nur 1,2 Millionen Menschen nutzen sie aktiv. Diese Diskrepanz zeigt, wie groß die Kluft zwischen Verfügbarkeit und tatsächlicher Anwendung ist.
Laut der Techniker Krankenkasse (TK) wurden 11 Millionen Akten angelegt, aber nur 750.000 davon sind in regelmäßigem Gebrauch. Auch die Barmer meldet ähnliche Zahlen: 7,8 Millionen Akten stehen bereit, doch lediglich 250.000 Zugriffe erfolgen regelmäßig.
Der AOK-Bundesverband verzeichnet sogar 25,8 Millionen E-Akten, von denen nur 200.000 mit einer Gesundheits-ID verknüpft sind. Experten wie TK-Chef Jens Baas betonen die Notwendigkeit, die digitale Akte im Alltag zu etablieren.
Ein Paradox bleibt: Während Praxen, Kliniken und Apotheken wöchentlich 40 Millionen Zugriffe auf die E-Akte verzeichnen, bleibt die aktive Nutzung durch Versicherte gering. Mehr dazu erfahren Sie im ZDF-Bericht.
Aktuelle Situation der elektronischen Patientenakte (ePA)
Die elektronische Patientenakte (ePA) ist in Deutschland flächendeckend verfügbar, doch ihre aktive Nutzung bleibt hinter den Erwartungen zurück. Über 70 Millionen gesetzlich Versicherte besitzen bereits eine ePA, aber nur ein kleiner Teil greift regelmäßig darauf zu.
Verbreitung der ePA in Deutschland
Die Einführung der ePA wurde durch die Ampel-Reform und § 341 SGB V rechtlich verankert. Seit 2025 ist sie flächendeckend verfügbar. Aktuell sind 70.000 Einrichtungen an das System angeschlossen, mit dem Ziel, bis 2025 auf 160.000 zu wachsen.

Zahlen zur aktiven Nutzung
Die aktive Nutzung der ePA zeigt deutliche Unterschiede zwischen den Krankenkassen. Während Millionen von Akten angelegt wurden, bleibt die Zahl der regelmäßigen Nutzer gering. Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Daten zusammen:
| Krankenkasse | Anzahl Akten | Aktive Nutzer | Nutzungsrate |
|---|---|---|---|
| TK | 11 Millionen | 750.000 | 6,8% |
| Barmer | 7,8 Millionen | 250.000 | 3,2% |
| AOK | 25,8 Millionen | 200.000 | 0,78% |
Ein weiterer kritischer Faktor ist die geringe Anzahl von Gesundheits-IDs. Bundesweit sind nur 3,1 Millionen solcher IDs registriert. Ärzte können jedoch auch ohne aktive Nutzung durch die Versicherten auf die Akten zugreifen, was zu einer Nutzungsanomalie führt: Wöchentlich gibt es 40 Millionen medizinische Zugriffe, aber nur 1,2 Millionen aktive Patientenzugriffe.
Gründe für die geringe Nutzung der ePA
Trotz moderner Technologie und flächendeckender Einführung wird die elektronische Patientenakte (ePA) kaum genutzt. Millionen von Akten stehen bereit, doch die aktive Nutzung bleibt gering. Warum zögern so viele Versicherte, diese digitale Lösung zu verwenden?
Technische Hürden und mangelnde Aufklärung
Ein Hauptgrund sind technische Hürden. Die Freischaltung der ePA erfordert eine 2-Faktor-Authentifizierung, entweder über die eID oder die Gesundheitskarte mit PIN. Für viele ist dieser Prozess zu komplex. Laut einer Umfrage nennen 78% der Nichtnutzer die komplizierte Freischaltung als Haupthemmnis.
Hinzu kommt ein Aufklärungsdefizit. Nur 34% der Versicherten kennen die Sperrfunktion für sensible Gesundheitsdaten. Viele fühlen sich überfordert, wenn sie die Verantwortung für ihre digitalen Daten übernehmen sollen.
Datenschutzbedenken der Patienten
Ein weiteres Problem sind Datenschutzbedenken. 62% der Befragten befürchten unberechtigten Zugriff auf ihre Daten. Obwohl die ePA mit 256-Bit-Verschlüsselung gesichert ist, bleibt das subjektive Unsicherheitsgefühl groß.
Rechtliche Bedenken spielen ebenfalls eine Rolle. Ungeklärte Haftungsfragen bei Datenlecks verunsichern viele. Thomas Fuchs, Datenschutzbeauftragter, betont: „Vertrauen ist der Schlüssel zur Akzeptanz.“
Ein Lösungsansatz könnte die vereinfachte PIN-Beantragung über die Krankenkassen-App sein. Zukünftig ist auch biometrische Authentifizierung geplant, um die Nutzung zu erleichtern.
Rolle der Krankenkassen und Ärzte
Krankenkassen und Ärzte spielen eine Schlüsselrolle bei der Förderung der ePA. Ihre Initiativen und Verpflichtungen sind entscheidend für die erfolgreiche Integration der digitalen Akte in den medizinischen Alltag.
Initiativen der Krankenkassen zur Förderung der ePA
Die Techniker Krankenkasse (TK) hat das Programm „ePA-Coaching“ in 500 Hausarztpraxen gestartet. Ziel ist es, Ärzte und medizinisches Personal bei der Nutzung der ePA zu unterstützen. Die AOK investiert 15 Millionen Euro in Praxissoftware-Updates, um die technische Infrastruktur zu verbessern.
Die Barmer setzt auf Aufklärung: Videoanleitungen zur ePA verzeichneten bereits 500.000 Aufrufe. Zudem bietet die Gematik Schulungen für 120.000 medizinische Fachangestellte an, um die technische Kompetenz zu stärken.

Verpflichtung der Ärzte ab Oktober
Ab dem 1. Oktober 2025 sind Ärzte gesetzlich verpflichtet, die ePA für die Dokumentation zu nutzen. Laut § 295a SGB V müssen alle relevanten Dokumenten in der digitalen Akte gespeichert werden. Bei Nichteinhaltung drohen stufenweise Sanktionen.
Dr. Meier aus München berichtet: „Die ePA hat unseren Workflow optimiert, aber die Doppeldokumentation kostet Zeit.“ Ein kassenübergreifendes Projekt, „ePA-Connect“, soll die Schnittstellen vereinheitlichen und die Nutzung erleichtern.
| Initiative | Krankenkasse | Details |
|---|---|---|
| ePA-Coaching | TK | 500 Hausarztpraxen |
| Praxissoftware-Updates | AOK | 15 Mio. € Investition |
| Videoanleitungen | Barmer | 500.000 Aufrufe |
„Vertrauen ist der Schlüssel zur Akzeptanz der ePA. Wir müssen Ärzte und Patienten gleichermaßen unterstützen.“
Die Zukunft der ePA sieht vielversprechend aus: KI-gestützte Datenextraktion aus Arztbriefen und automatische Benachrichtigungen bei neuen Einträgen sind geplant. Diese Innovationen sollen die Versorgung weiter verbessern.
Zukünftige Entwicklungen und Erwartungen
Die Zukunft der elektronischen Patientenakte (ePA) verspricht zahlreiche Innovationen und Verbesserungen. Mit neuen Funktionen und Technologien soll die digitale Akte die medizinische Versorgung revolutionieren und die Nutzung für Versicherte und Ärzte erleichtern.
Geplante Funktionen und Verbesserungen
Ab Q3/2025 wird der digitale Medikationsplan eingeführt. Dieser ermöglicht es, Medikationsdaten in Echtzeit zu synchronisieren. 2026 folgt die Integration von Impfpass und Allergiekarte, um alle relevanten Daten zentral zu speichern.
Die Gematik-Roadmap sieht ab 2027 die Einführung des Notfalldatensatzes vor. Zudem sind Sicherheitsupgrades wie blockchain-basierte Zugriffsprotokollierung geplant. Diese Maßnahmen sollen das Vertrauen in die ePA stärken.
Auswirkungen auf die medizinische Versorgung
Die neuen Funktionen werden die medizinische Versorgung nachhaltig verbessern. Studien zeigen, dass in Pilotregionen Medikationsfehler um 23% reduziert wurden. Bis 2030 könnten Einsparungen von 4,2 Milliarden Euro erreicht werden.
Ein weiterer Vorteil ist die Reduktion von Doppeluntersuchungen um 17%. Ärzte können schneller auf relevante Informationen zugreifen, was die Behandlung effizienter macht. Die Integration von Wearable-Daten ab 2026 wird die Präzision weiter erhöhen.
| Funktion | Startjahr | Vorteil |
|---|---|---|
| Digitaler Medikationsplan | 2025 | Echtzeit-Synchronisation |
| Impfpass & Allergiekarte | 2026 | Zentrale Datenspeicherung |
| Notfalldatensatz | 2027 | Schnelle Notfallversorgung |
Langfristig soll die ePA die Papierakte vollständig ersetzen. Bis 2035 wird eine flächendeckende Nutzung angestrebt. Diese Entwicklung wird die medizinische Versorgung in Deutschland nachhaltig prägen.
Fazit
Die digitale Transformation im Gesundheitswesen steht vor einer entscheidenden Weichenstellung. Trotz einer Verbreitung von 94% liegt die aktive Nutzung der elektronischen Akte bei nur 1,7%. Ein Schlüsselfaktor wird die gesetzliche Verpflichtung für Ärzte ab Oktober sein, die als Wendepunkt dienen könnte.
Technische Innovationen wie die biometrische Authentifizierung könnten die Nutzung erheblich vereinfachen. Gleichzeitig bleibt die gesellschaftliche Herausforderung bestehen: Digitalkompetenz und Datensensibilität müssen in Einklang gebracht werden.
Rechtlich wird die EU-weite Interoperabilität ab 2026 eine wichtige Rolle spielen. Die ePA wird zunehmend als digitaler Zwilling der Patientenhistorie gesehen. Eine Kombination aus vereinfachter Bedienung und gezielter Aufklärung ist entscheidend für die Akzeptanz.
Langfristig wird die ePA eine integrierte Versorgungskette ermöglichen – vom Hausarzt bis zur Spezialklinik. Dabei müssen Cybersecurity-Risiken kontinuierlich adressiert werden. Der Digitalisierungstrend ist unumkehrbar, bietet aber erhebliches Optimierungspotenzial.